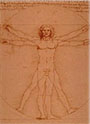Das (allgemeine) Menschenrecht bleibt ein ungedeckter Scheck, wenn ich es nicht bei einer höheren Instanz, dem Staat oder einer, in sich durch Regeln des Zusammenlebens gefestigten, äußerlich aber unabhängigen Gemeinschaft einfordern kann. Der Staat oder eine autonome Gemeinschaft sind die Vorbedingung meiner individuellen "menschlichen" Freiheit, also um meine geglaubten Menschenrechte durchsetzen, irgenwo bei irgendwem einlösen zu können.
Am eigenen Leibe erfährt das jeder Migrant, der plötzlich staatenlos ist und auf des Wohlwollen anderer Staaten oder Menschen bauen muss, der sozusagen um seine geglaubten Rechte betteln gehen muss, wie es z.B. den aus Nazi-Deutschland rausgeekelten Juden ging, die nun glaubten sich ihrer so gewonnen Freiheit erfreuen zu dürfen, aber jetzt als Staatenlose erfahren mussten, dass sie kaum einer haben wollte und nun hilflos auf dem Ozean herumirrten, bis sie die Briten in Palästina ansiedelten, um das leidige, dem moralischen Ansehen schadenden Problem, aber nicht auf ihre eigenen Kosten, sondern auf das der Palästinenser, endlich los zu werden.
Und wenn meine und des Jungen Handlungen nicht durch den Staat tolerieret werden, dann ist es bitter notwendig, dass wir, der Junge und ich, selbst die Verantwortung für unser Tun übernehmen. Das können wir aber nur, wenn wir beide uns des rechtlichen Risikos mit all seinen Konsequenzen bewusst sind.
Das ja macht die Besonderheit des Menschen unter den anderen Tieren aus: dass er fähig ist, die Folgen seines (nicht durch den Staat abgesegneten) Tuns abstrakt be"denken" zu können und sei es auch nur, um wenigstens seinen Partner nicht in die offene Klinge der drohenden Verfemung laufen zu lassen, wenn ihm das eigene (gesellschftliche) Schicksal schon egal sein sollte.
Alexander Mitscherlich:
Vier Grundkomponenten der Anpassung an die menschliche Mitwelt
Wir können zum Zweck modellhafter Vergegenwärtigung vier Grundkomponenten der Anpassung an die menschliche Mitwelt unterscheiden:
1. Anpassung passiver Art an die bestehenden Verhältnisse. Dieser Vorgang ist augenfällig mit Lernen verknüpft, mit Erlernen von Regeln, Vermeidungen, Symbolen, insbesondere der Sprache.
2. Als Spiegelung dieser passiven Anpassung an die sozialen Lebensformen vollziehen wir eine ebensolche Anpassung nach innen, das heißt, wir formen unsere Triebkräfte und Befriedigungen nach den Forderungen der Außenwelt. »Passiv« in dieser Definition heißt also, daß wir in uns entstehende triebhafte Impulse nicht nur egoistisch, autistisch, sondern nach dem vorgefundenen Verhaltensstil gestalten, in dem oft ein Verzicht, ein Aufschieben, eine Zielvertauschung gefordert werden.
3. Aktive Anpassung nach außen erreichen wir dann, wenn es uns gelingt, unsere Mitwelt durch unsere Impulse so weit auf uns einzustimmen, daß sie auf uns eingeht, daß unsere Absichten die mit ihnen geschaffene Situation aktiv gestalten.
4. Spiegelbildlich entspricht dem die aktive Anpassung nach innen. Wir übernehmen dann nicht blindlings, passiv-gehorsam vorgeschriebene Formen des Verhaltens, sondern modifizieren. Bestimmte Triebregungen gegenüber bestimmten Personen der Mitwelt mögen nach der Idealnorm der Gesellschaft nicht passend sein, wir erlauben es uns trotzdem, sie zu empfinden, in uns wahrzunehmen oder gar zu äußern. Wir übernehmen also die Initiative und damit auch eine doppelte Verantwortung vor uns selber wie vor der sozialen Mitwelt. Denn an unserem Gesamtverhalten kann die Gesellschaft nur ein bescheidenes Maß individueller Initiative ertragen, wenn nicht dabei der Gruppenzusammenhalt gesprengt werden soll.
ecci